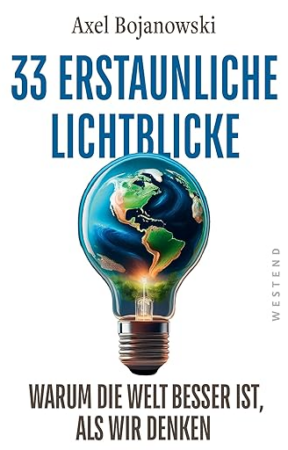
Wenn es nach den Berichten und Kommentaren der Medien geht, dann sind Hunger, Bildungsnotstand, Ressourcenknappheit, Wassermangel und Krankheiten unausrottbare Geißeln der Menschheit, vor allem in den ärmeren Ländern. Fragt man entsprechend die Menschen danach, wie groß diese Probleme sind und ob sie geringer oder größer werden, verschätzen die meisten sich massiv zum Schlechteren.
Gegen diese Negativverzerrung schreibt Axel Bojanowski mit 33 oft eindrucksvollen Berichten von dramatischen Verbesserungen an. Er berichtet vom starken Rückgang extremer Armut, trotz starkem Bevölkerungswachstum, von einer noch dramatischeren Verbesserung der Bildungssituation in armen Ländern, von einer Lebenserwartung, die dort inzwischen meist fast so hoch ist wie in den reichen Ländern, von wachsenden Landmassen auf der Erde, trotz (langsam) steigendem Meeresspiegel. Selbst in Bangladesch, dem Land, von dem es immer hieß, ein Drittel werde im Meer versinken, nimmt die Landmasse zu. Auch die Anzahl der Opfer von Wetterkatastrophen ist trotz rapidem Bevölkerungsanstieg stark gesunken.
Das sind alles Befunde, die in ihrem Ausmaß die meisten und selbst der Richtung nach viele überraschen werden. Sie taugen als Mittel gegen übertriebenen Pessimismus. Sie können zeigen, dass die Welt nicht ganz so schlecht ist, wie viele denken, eventuell auch, dass sie noch besser ist, als selbst moderate Optimisten meinen. Insofern löst Bojanowski ein, was der Untertitel verspricht. Das wäre geeignet, den Lesern Mut zu machen, dass es sich lohnt sich für weitere Verbesserungen der Zustände zu engagieren.
Allerdings wählt Bojanowski fast durchgängig Formulierungen, die deutlich weiter gehen. Mit den Beispielen will er uns überzeugen, ja fast nötigen, seiner impliziten Aussage zuzustimmen, dass wir bereits in der besten aller möglichen Welten leben, und dass, wer daran zweifelt, wer auf Misstände und auf Probleme zum Beispiel neuer Technologien hinweist, ein ewiger Pessimist und Nörgler ist.
Das fängt bei der Einführung an, in der der Autor es komplett versäumt, Pessimisten bei ihren Sorgen abzuholen, sondern stattdessen seitenlang einen Fortschritt der letzten Jahrhunderte nach dem anderen aufzählt. Erst am Ende des Vorworts räumt er summarisch ein, dass es immer noch viel zu verbessern gibt, dass „der Fokus allein auf Fortschritte in die Irre führen“ würde, weil übertriebener Optimismus ebenso lähme wie übertriebener Pessimismus.
Das scheint aber eher ein nachträglicher Gedanke gewesen zu sein, denn im Buch macht es sich nicht bemerkbar, weder inhaltlich, noch im Ton. Und am Ende macht Bojanowski sogar noch explizit, dass er es nicht so ernst meint mit der Anerkennung von Problemen, wenn er ein Kapitel überschreibt mit: „Die ewige Quengelei der Fortschrittsskeptiker“.
Das Buch ist lesenswert, will ich noch einmal betonen, bevor ich meinerseits ein paar weitere Quengeleien anbringe. Für Bojanowski ist jede realisierte technologische Entwicklung ein Fortschritt. Doch nicht jede Neuerung ist Fortschritt im Sinne von Verbesserung für die Gesellschaft. Denn in der kapitalistischen Marktwirtschaft ist der private Gewinn der Maßstab, ob sich eine Neuerung durchsetzt, und nicht der gesellschaftliche Nutzen, wie Bojanowski unterstellt. Deshalb sind ungebremste Marktkräfte – anders als der Autor nahelegt – auch keine Garantie für größtmöglichen „Fortschritt“. Man denke nur an die sogenannten sozialen Medienplattformen, die uns und vor allem unsere Kinder gezielt süchtig gemacht haben, so sehr, dass sie den allergrößten Teil ihrer freien Zeit am Bildschirm verbringen, ihre Konzentrationsfähigkeit und Geduld verlieren und immer unglücklicher werden.
Verteilungsprobleme verharmlost der Autor, meist implizit mit Durchschnittswerten, manchmal auch explizit, indem er darauf verweist, dass es den Armen heute materiell besser gehe als Reichen in vergangen Jahrhunderten. Das Glück der Menschen hängt aber nicht allein vom Materiellen ab, die relative Position in der Gesellschaft, der Respekt, der einem entgegengebracht wird, oder nicht, ist wichtiger. Die durchaus belegbare Wahrnehmung vieler, dass es für sie oder für die Gesellschaft seit einiger Zeit nicht mehr aufwärts geht, sondern abwärts, ist ein Hauptgrund für die wachsende Unzufriedenheit. Er kommt nicht vor. Dass Bojanowski den Unzufriedenen vorhält, dass es ihren Urgroßeltern viel schlechter ging, wird sie kaum trösten und vom „quengeln“ abhalten.
Fazit
Wer sich selbst oder andere überzeugen möchte, dass die Welt nicht so schlecht ist, wie man aufgrund des Medienkonsums meinen könnte, kann in diesem Buch viele nützliche Vergleiche und Statistiken finden. Vor der unreflektierten Aufnahme der mitgelieferten Ideologie sei allerdings gewarnt.
