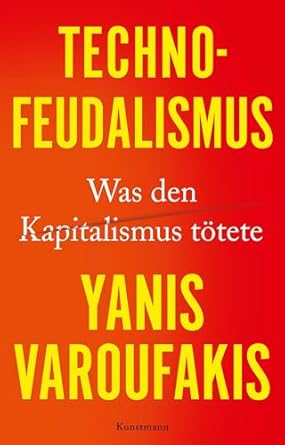
Yanis Varoufakis ist ein hervorragender Ökonom. Er wurde bekannt als griechischer Finanzminister während der kurzen Syriza-Regierungszeit, als Griechenland inmitten der Euro-Krise gegen das Diktat von Frankfurt (EZB), Berlin, Brüssel und Washington (IWF) aufbegehrte. Er scheiterte an der Übermacht der Europäischen Zentralbank und der Regierung von Deutschland und den anderen Nordländern, die mit allen Mitteln die Vorherrschaft und die Privilegien ihres Finanzsektors verteidigten. Dessen Forderungen mussten beglichen werden, koste es die Griechen, was es wolle. Kaum jemand weiß daher so gut wie er um die Macht des Finanzsektors. Vielleicht liegt es daran, dass er das Finanzsystem etwas mehr bemüht als ich, wenn er den Weg in den Technofeudalismus beschreibt.
Varoufakis hat recht, wenn er ausführlich beschreibt und betont, welch große Bedeutung es hat, dem, was man in der Welt beobachtet, einen Namen zu geben, der seine Essenz beschreibt. Denn nur was man benennen kann, kann man analysieren und verstehen, und bei Bedarf bekämpfen. Deshalb kann man ihm zu dem treffenden Namen, den er gefunden hat, nur gratulieren. „Digitale Technokratie“ wäre auch nicht schlecht, aber „Technofeudalismus“ ist noch besser.
Das Buch ist im Stil eines Briefes an seinen marxistischen Vater geschrieben. Dieser war davon ausgegangen, dass die Überwindung des Kapitalismus in den ersehnten Sozialismus führt. Varoufakis muss ihm leider mitteilen, dass der Kapitalismus gerade durch etwas noch Schlimmeres zurückgedrängt und abgelöst wird. Der Unterschied zwischen beiden geht auf den Unterschied zwischen Profit und Rente zurück, erklärt er. Es ist ein schwer zu erklärender Unterschied, weil beide rechnerisch dasselbe sind. Rente im Ökonomenjargon ist leistungsloses Einkommen, das man zum Beispiel als Rentner bezieht (klar, man hat früher dafür durchaus etwas geleistet), aber auch als Bodenbesitzer. Allein für den Besitz von Boden, den man verpachtet, bekommt man ein Einkommen. Man muss nichts dafür tun. Das ist anders als beim Profit, den man erzielt, wenn man etwas produziert.
Beides errechnet sich als das, was übrig bleibt, wenn man die Erlöse von den Kosten abzieht. Aber Profit ist bedroht durch Konkurrenz. Diese schafft Leistungsdruck. Daher kommt die falsche Gleichsetzung von Kapitalismus und Wettbewerbswirtschaft in vielen Köpfen und Lehrbüchern. Aber Wettbewerb geht auch ohne Kapitalismus. Kapitalismus ohne Wettbewerb allerdings wird zu etwas anderem, zu dem, was Varoufakis beschreibt, zu einer Wirtschaftsordnung, in der, wie damals im Feudalismus, die Renteneinkommen dominieren. Renteneinkommen sind Einkommen, die nicht (mehr) durch Konkurrenz bedroht sind.
Die starke Tendenz zur Konzentration bei den Gewinnern des Wettbewerbs, die dem Kapitalismus innewohnt und die durch die Eigenheiten der Digitalwirtschaft verstärkt wird, hat dafür gesorgt, so Varoufakis, dass der Wettbewerb immer weniger wurde. Stark dazu beigetragen hat die von den Zentralbanken vor dem Jahrtausendwechsel begonnene Geldschwemme zur Bekämpfung einer Serie von immer schwereren Finanzkrisen. Der Finanzsektor, dem das Geld kostenlos oder zu Negativzinsen in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung gestellt wurde, finanzierte damit die oft lange Zeit sehr verlustträchtige Expansion von Digitalkonzernen wie Amazon und Uber. Diese konnten viele Milliarden Dollar Verlust anhäufen, während sie wuchsen und wuchsen und immer mehr Konkurrenten aus ihren Märkten verdrängten.
Heute sind eine Handvoll Digitalkonzerne in den USA viel mehr Wert als alle Aktiengesellschaften Europas zusammen. Der Wert einer Aktiengesellschaft ist ein Maß für seine Marktmacht, denn er speist sich aus den Gewinnen, besser Renten, der Zukunft, die man diesen Konzernen zutraut. Der Unternehmenswert ist auch ein Maß für die politische Macht dieser Konzerne. Sie können Unsummen für die besten Juristen, Ökonomen und PR-Fachleute ausgeben, um Regierungen und Öffentlichkeit freundlich und gefügig zu stimmen, und sie tun das auch. Sie können gelassen zuschauen, wie Start-Ups Neues entwickeln, denn deren Erfolge können ihnen nicht gefährlich werden. Wenn sie etwas Nützliches entwickelt haben, werden sie gekauft oder notfalls zerstört.
Am Geschäftsmodell von Amazon lässt sich sehr schön beschreiben, wie der Technofeudalismus der schönen neuen digitalen Welt funktioniert. Amazon gehört der Marktplatz und das Unternehmen bekommt von jedem, der darauf verkaufen will, einen Wegezoll. Amazon weiß alles über die Nachfrager und alles über die Anbieter. Amazon entscheidet auch, welche Produkte die Nachfrager bevorzugt oder überhaupt zu sehen bekommen. Amazon kann den Preis, den die einzelnen Nachfrager angezeigt bekommen, variieren und an die geschätzte Zahlungsbereitschaft anpassen. Amazon tritt auch selbst als Anbieter auf. Dort wo das Unternehmen bei den Fremdanbietern hohe Gewinne vermutet, kann es selbst in den Markt eintreten, und seine privilegierten Informationen über die Anbieter und die Nachfrager nutzen, um Konkurrenten zu verdrängen.
Das Ergebnis sieht zwar noch aus wie ein Markt, aber es hat in Wahrheit nicht mehr viel mit dem freien Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage zu tun. Ähnlich wie im feudalen Mittelalter gibt es eine Machtzentrale, von deren Gnaden die nachgeordneten Ebenen ihre Lehen bewirtschaften dürfen. Und die Konsumenten und Arbeitnehmer, deren Präferenzen und Möglichkeiten man in der Zentrale genau kennt, ähneln, wenn sich das Amazon-Modell zur Gänze durchgesetzt hat, viel eher den Untergebenen eines Pharao, den Rädchen in der von diesem beaufsichtigen sozialen Megamaschine, als wirklich freien Menschen. Der Unterschied ist nur, dass die modernen Pharaonen ein sehr viel größeres Steuerungspotenzial haben und dadurch die Potentiale der Menschen sehr viel besser zum eigenen Nutzen zur Geltung kommen lassen können.
Weniger überzeugend als die Analyse ist das Schlusskapitel darüber, wie wir dem Technofeudalismus entkommen können. Dafür entwirt Varoufakis ein Alternativ-Szenario eines IT-technisch unterstützten Anarcho-Sozialismus. Darin gehören die Unternehmen den Arbeitnehmern. Dank der Möglichkeiten der Informationstechnologie stimmen diese laufend über alle anstehenden Unternehmensentscheidungen ab. Auf mich wirkt das sehr naiv-technikgläubig. Hinzu kommt, dass die Arbeitnehmer nicht die einzigen Interessenträger eines Unternehmens sind. Die gute alte Genossenschaft, an die Varoufakis gar nicht zu denken scheint, hat aus meiner Sicht deutlich größeres Potenzial als Kern einer Alternative zu Kapitalismus und Technofeudalismus.
