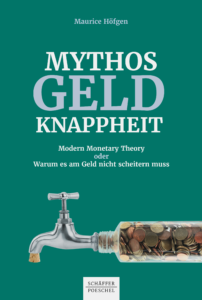
„Mythos Geldknappheit – Modern Monetary Theory oder Warum es am Geld nicht scheitern muss“ ist ein gut geschriebenes Buch, das aus einer links-progressiven Perspektive die Erkenntnisse und Verheißungen der Modern Monetary Theory verständlich erklärt und dafür wirbt, diese für die Errichtung einer besseren Gesellschaft einzusetzen. Es hat 264 Seiten und kostet 24,95 Euro.
Ich halte die Modern Monetary Theory für im Kern hilfreich und richtig. Gleichzeitig überreizen die Vertreter der Theorie aus meiner Sicht gern ihr Blatt – so auch Höfgen. Wie beim Pokern kann das dazu führen, dass man die Ziele des Gegner fördert, nicht die eigenen. Das will ich anhand der Einführung des Buches und des Kapitels zur Jobgarantie begründen, die ich (gekürzt) als Leseproben präsentiere. Maurice Höfgen antwortet jeweils kurz.
Leseprobe 1
Einleitung: Die Wirtschaft als Mittel zum Zweck
Wie soll die Welt in fünf, zehn oder fünfzig Jahren idealerweise aussehen? Welche Reformen bräuchte es Ihrer Meinung nach, um dorthin zu gelangen? Was immer Ihre Antworten auf diese Fragen sind, am Geld muss es nicht scheitern. All das, wozu wir technisch in der Lage sind und worauf wir uns demokratisch einigen können, können wir uns auch leisten. Eine Zukunft in nachhaltigem Wohlstand und in Abwesenheit von Existenzängsten ist möglich. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir unser ökonomisches Denken und unsere Wirtschaftspolitik schnellstmöglich in Ordnung bringen. Das erfordert, dass wir verstehen, wie unser modernes Geldsystem funktioniert und wie wir jenes im Sinne des Gemeinwohls nutzen können. Darum soll es in diesem Buch gehen: eine Erklärung der Funktionsweise unseres Geldsystems, der grundlegenden ökonomischen Zusammenhänge sowie darauf aufbauende, progressive Vorschläge für eine Zukunft in Prosperität, Solidarität und Nachhaltigkeit.
Margaret Thatcher, ehemalige Premierministerin des Vereinigten Königreichs, prägte ihrerzeit den Satz »There is no alternative«, der zum Sinnbild des neoliberalen Dogmas wurde, das heute noch sowohl den öffentlichen Diskurs, die Politik als auch die Universitäten dominiert. Bedeutende gesellschaftliche Probleme sind nach wie vor ungelöst bzw. wurden durch den seit den 1980er-Jahren aufblühenden neoliberalen Zeitgeist gar noch verstärkt. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit zerstört individuelle Lebensentwürfe und lässt Familien auseinanderbrechen. Armut ist – auch in vermeintlich reichen Gesellschaften – immer noch nicht überwunden. Staatliche soziale Sicherheitsnetze sind lückenhaft, sodass vor allem untere Einkommensgruppen von Existenzängsten geplagt werden.
Der demografische Wandel bringt ausgedünnte Pflege- und Gesundheitssysteme an ihre Belastungsgrenze. Die Einkommens- und Vermögensungleichheit hat Ausmaße angenommen, die den sozialen Frieden und das Funktionieren der Demokratie infrage stellen. Wir riskieren mit dem menschengemachten Klimawandel unsere Existenz auf diesem Planeten. Klimawandel, Kriege, Hunger und Perspektivlosigkeit zwingen Millionen Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen und eine neue Bleibe zu finden. Vielfach herrscht Ellbogen statt Kooperation. So viel zum Zustand unserer Welt.
(…)
Zu den »Sachzwängen« gehören, dass eine lebensstandardsichernde Rente, umfassende Gesundheits- und Pflegeversorgung, erstklassige Bildung und eine Modernisierung der Infrastruktur nicht mehr finanzierbar seien oder dass dem Staat angesichts der Globalisierung bei der Verfolgung einer gemeinwohlorientierten Politik die Hände gebunden seien. Diese Mythen sollen sich zwar bei einem Verständnis der ökonomischen Zusammenhänge als bloße Fiktion herausstellen, wie ich in diesem Buch zeigen werde, fungieren aber effektiv als Zwangsjacke für progressive Wirtschaftspolitik. So bitter es ist: Sowohl Linke als auch Konservative erkennen ihre eigenen Widersprüche nicht und sorgen so für eine gesellschaftlich bedenkliche, gefährliche Repräsentationslücke.
Wer also den politischen Rechtsruck zu adressieren beabsichtigt, kommt um eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung und eine Abkehr vom Neoliberalismus nicht herum. Dazu gehört auch eine Abkehr vom übermäßigen Individualismus, der zu einer Atomisierung der Gesellschaft geführt hat. Das linke Spektrum gibt sich zu oft mit moralischer Überlegenheit zufrieden und verzettelt sich in Kulturkämpfen, aber verpasst dringend benötigte Wahlerfolge und verliert dadurch mehr und mehr den Anschluss an die Klasse der am meisten Benachteiligten – und damit vor allem auch an Nicht- und Protestwähler.
Diverse Umfragen zeigen, dass es in der Gesellschaft Mehrheiten für soziale Kernthemen gibt, vom Mindestlohn über Arbeitsschutz bis zum Wunsch nach sinnstiftender Beschäftigung und der Ausweitung öffentlicher Daseinsvorsorge, die sich in den Mehrheitsverhältnissen der Parteien aber nicht widerspiegeln. Um diese Mehrheiten (wieder) zu gewinnen, braucht es eine progressive Utopie, die in eine neue Rahmenerzählung eingebettet ist. Eine Rahmenerzählung, die die originären Bedürfnisse der Menschen nach Sicherheit, Zusammenhalt und Mitbestimmung ins Zentrum stellt und den Staat als (monetär) souveräne, demokratische, dynamische, fürsorgliche Institution konzeptualisiert.
Eine Rahmenerzählung, die ein solidarisches Wir-Gefühl und einen Aufbruch in die Zukunft vermittelt. Dazu gehört zwingendermaßen, den ökonomischen Mythen und der neoliberalen Globalisierung den Rücken zu kehren! Die drängenden Herausforderungen unserer Zeit haben natürlich multiple Ursachen, die – salopp gesprochen – nicht auf einen Bierdeckel passen. Ein Faktor aber, der allen zuvor genannten Problemen sowie deren fatalen sozioökonomischen Konsequenzen zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass der Mainstream der ökonomischen Wissenschaft seit Jahrzehnten keinen Fortschritt gemacht hat. (…)
Ohne Frage: Für gesellschaftlichen Fortschritt und eine gerechte, wohlhabende und nachhaltige Zukunft braucht es neue Lösungen – aus neuen Denkschulen. Um es mit Einsteins Worten zu sagen: »Probleme lassen sich nicht mit der gleichen Denke lösen, mit der sie entstanden sind«. (…)
Geld ist eine nützliche Erfindung – vielleicht die nützlichste Erfindung, die jemals gemacht wurde. Leider scheint es, als hätten wir vergessen, wie wir diese Erfindung bestmöglich für unsere Gesellschaft einsetzen. Der originäre Zweck des Geldsystems ist die Ermöglichung einer adäquaten Bewirtschaftung und Auslastung der vorhandenen Ressourcen zwecks Herstellung der Güter und Dienstleistungen, die unsere Bedürfnisse und Wünsche stillen. In Anbetracht der weitverbreiteten Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie der mangelnden öffentlichen Daseinsvorsorge und verfallenden Infrastruktur, die allesamt als Beweis dafür gelten, dass wir unterhalb unserer Möglichkeiten leben und die Wirtschaft unterhalb ihrer Möglichkeiten auslasten, scheint dieses Verständnis im ökonomischen, öffentlichen sowie politischen Diskurs nicht existent.
In der Tat sind folgenreiche Missverständnisse zur Funktionsweise unseres heutigen Geldsystems – vor allem, was die Rolle des Staates als Herausgeber der Währung und den sich daraus ergebenden Handlungsspielräumen betrifft – in Wissenschaft, Medien und Politik weit verbreitet und tief verfestigt. Staatsschulden werden als Belastung für zukünftige Generationen gesehen. Staatliche Defizite werden hysterisch verteufelt. Der Staat funktioniere wie ein von uns geführter Privathaushalt. Wer nicht genügend einnimmt, um seine Rechnungen zu bezahlen, der wirtschaftet schlecht, der hat unternehmerisch versagt – so das verbreitete Narrativ, das an unsere eigenen Erfahrungen des Wirtschaftens appelliert und daher oberflächlich und intuitiv richtig erscheint. Da unsere Geisteshaltungen ein Produkt unseres Umfeldes sind, maßgeblich geprägt von den Strukturen, den Normen und den verfestigten Denkmustern, in denen wir aufgewachsen sind und die wir so passiv übernommen haben, ist es ratsam, dass wir unserer Intuition nicht immer unkritisch folgen.
Bezeichnenderweise ist es dieselbe Margaret Thatcher, von der die bekannte neoliberale Phrase »There is no alternative!« stammt, die auch den Geist der Geldknappheit prägte, indem sie sagte: »There is no such thing as public money, there is only taxpayers’ money«, zu Deutsch: »So etwas wie staatliches Geld gibt es nicht, es gibt nur das Geld der Steuerzahler«. Wie in diesem Buch aufgedeckt werden wird, ist genau das Gegenteil wahr: »There is no such thing as taxpayer’s money, there is only public money«, zu Deutsch: »So etwas wie das Geld des Steuerzahlers gibt es nicht, es gibt nur staatliches Geld«.
Was die Ökonomie anbelangt, denken wir zumeist in falschen Mustern und legen häufig verkehrte Maßstäbe an. Insbesondere unsere Auffassung vom Konzept der Knappheit ist verzerrt. Während wir Geld als knappe Ressource begreifen, behandeln wir natürliche Ressourcen so, als hätten wir unendlich davon. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Geld als soziales Konstrukt unterliegt keiner natürlichen Knappheit, Ressourcen hingegen schon. Das, was wir uns gesellschaftlich leisten können, ist keine Finanzierungsfrage, sondern eine Frage der Ressourcen. Die finanzielle Kapazität eines währungsherausgebenden Staates ist kein Kuchen, der kleiner wird, sobald man ein Stück abschneidet – eine der wohl wichtigsten Einsichten, die vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Herausforderungen, in die wir uns hineinmanövriert haben, schnellstmöglich in der Wirtschaftspolitik ankommen muss.
Die Funktionsweise des Geldsystems scheint die größte intellektuelle Hürde für die Umsetzung einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftspolitik unserer Zeit zu sein. Wie aber können wir erwarten, dass die Wirtschaftspolitik die richtigen Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen findet, wenn sie noch nicht einmal die richtigen Fragen stellt? Kein Wunder, dass wir politisches Klein-Klein, ein Verzetteln in unsinnigen Debatten und ein Auf-der-Stelle-Treten erleben.
Während in der Eurozone das Geldsystem derart ausgestaltet ist, dass es die Hände der Regierungen der Mitgliedsländer wirtschaftspolitisch in Ketten legt – manchen Ländern, wie etwa Griechenland, Spanien oder Italien, sogar die Luft zum Atmen nimmt –, wird in anderen Ländern, etwa denen, die ihre eigene Währung ausgeben, der vorhandene wirtschaftspolitische Handlungsspielraum schlicht nicht erkannt und nicht genutzt. Überdies schikanieren die verfestigten ökonomischen Mythen die Demokratie, deren wichtigste Funktionsbedingung die Verfügbarkeit von korrekten Informationen ist. Solange Universitäten, Politiker und Medien aber mit irrtümlichen Narrativen den öffentlichen Diskurs und damit unsere Wahlentscheidungen manipulieren können, wird es schwierig, demokratische Mehrheiten für eine Wirtschaftspolitik zu gewinnen, die die bevorstehenden gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen vermag.
Daraus wird die Bedeutung ökonomischer Aufklärung ersichtlich. Lassen wir uns nicht länger von den falschen Leuten die Welt falsch erklären. Nur ein Verständnis des Geldsystems ermöglicht es uns, die richtigen Fragen zu stellen und progressive Antworten auf die gesellschaftlichen Problemstellungen zu finden. In diesem Geist ist dieses Buch aufgebaut. Bevor wir zu den wirtschaftspolitischen Reformvorschlägen, also zu der Frage, wie eine progressive Wirtschaftspolitik aussehen sollte, kommen, müssen wir uns dem Gerüst des Geldsystems, der Herkunft des Geldes, der Bedeutung monetärer Souveränität und anderen Aspekten wie Inflation, Steuern und Staatsanleihen widmen. Gewissermaßen einen Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne.
Nur ein modernes Verständnis des Geldsystems und der makroökonomischen Zusammenhänge bringt nämlich neue Lösungsansätze auf den Tisch. Lösungsansätze, die es für einen wirtschaftspolitischen Aufbruch braucht. Für eine Wirtschaftspolitik, die an funktionalen Zielen, wie z. B. Der Vermeidung unfreiwilliger Arbeitslosigkeit oder der Transformation auf eine ökologisch nachhaltige Produktionsweise, und nicht an beliebigen Finanzkennzahlen, wie z. B. Der Höhe des Staatsdefizits, gemessen wird. Für eine Wirtschaftspolitik, die eine adäquate und nachhaltige Bewirtschaftung unserer Ressourcen ermöglicht und uns so zu einem höheren Lebensstandard verhilft. Im Kern geht es darum: Wie setzen wir unsere realen Ressourcen (Technologie, Arbeitskraft, Energie, Land, natürliche Ressourcen etc.) bestmöglich ein, um unsere gesellschaftlichen Zielvorstellungen, das größtmögliche Gemeinwohl, zu erreichen.
Wenn wir eine Antwort darauf finden, dann kann das Geldsystem die Umsetzung ermöglichen. Ein anderer Wirtschaftsentwurf ist möglich. Eine für die breite Bevölkerungsmehrheit attraktive Alternative zum Neoliberalismus ist möglich. Lassen Sie uns dafür den Staat und dessen Möglichkeiten neu denken. Nichts ist alternativlos! Einleitend muss gesagt werden, dass die Ausführungen zum Geldsystem sowie die darauf aufbauenden Schlussfolgerungen maßgeblich durch die Denkschule der Modern Monetary Theory (MMT) inspiriert sind.
Diese Denkschule wurde von Warren Mosler, Bill Mitchell, Randall Wray und Mathew Forstater vor mehr als 20 Jahren geformt und steht auf den intellektuellen Schultern von Georg Friedrich Knapp, Mitchell A. Innes, John Maynard Keynes, Abba Lerner, Hyman Minsky und Wynne Godley. Was die MMT von anderen Denkschulen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie die Funktionsweise des Geldsystems als Ausgangspunkt der ökonomischen Analyse nimmt. Die zurzeit prominenteste Vertreterin ist Stephanie Kelton, die unter anderem Bernie Sanders in den USA wirtschaftspolitisch berät.
Mein Kommentar
Fast alles was ich hier als Leseprobe wiedergegeben habe, ist richtig und wichtig. Besonders betonen möchte ich die Botschaft, dass Geld nicht knapp ist. Am Geld muss es – wie wir nicht zuletzt an den Corona-Hilfsprogrammen bisher ungeahnter Größe gesehen haben – nie scheitern.
Aber, hier kommt mein großes Aber zu dem, was die Verfechter der Modern Monetary Theory aus dieser wichtigen Erkenntnis machen: Geld mag nicht knapp sein, aber die Bereitschaft zur Umverteilung ist sehr knapp, und all die Vorschläge der MMT-Verfechter sind enorm verteilungsrelevant. Das ist der Hauptgrund, warum der MMT-Optimismus übertrieben ist, man müsse nur das Verständnis für das Geldwesen verbessern und schon wäre der politische Weg in eine bessere Welt offen. Der Staat kann Geld, das er mehr oder weniger reichlich in Umlauf bringt, für alle möglichen, guten und schlechten Zwecke einsetzen, für Waffensysteme und Subventionen für umweltschädliche Produktion ebenso wie für bessere Renten und eine Jobgarantie.
MMT ist deshalb auch keine linke Theorie. Wichtige Vordenker kamen aus dem konservativen Lager und verdienten ihr Geld in der Finanzbranche. Die Finanzbranche ist traditionell keine Gegnerin staatlicher Defizite, denn sie verdient gut daran. Das muss jemand bezahlen, ein Punkt, den MMT-Verfechter gern ausblenden.
Der Hauptgrund, dafür, dass unsere Gesellschaft weniger solidarisch und egalitär ist als das linke Lager das gern hätte, ist nicht, dass die Funktionsweise des Geldsystems nicht verstanden wird – auch wenn das dazu beiträgt -, sondern dass diejenigen, die davon profitieren, mehr politischen, medialen und akademischen Einfluss haben als diejenigen, die darunter leiden.
Deshalb gilt umgekehrt auch nicht, dass es ohne Verständnis für und Umsetzung von MMT-Erkenntnissen keinen gesellschaftlichen Fortschritt geben kann. Man kann durchaus auch aus der – von MMT-lern verabscheuten – einfachen Perspektive, wonach der Staat sich durch Steuern finanziert, zu vernünftigen, umsetzbaren Vorschlägen kommen. Man kann zum Beispiel auch eine steuerfinanzierte Arbeitsplatzgarantie vorschlagen. Auch aus dieser Perspektive gilt: am Geld muss es nicht scheitern. Es gibt genug Reiche und Gutverdiener, die einen größeren Beitrag leisten könnten.
Wer gegen diesen Vorschlag ist, und warum, ist offensichtlich. An der Interessenlage ändert sich nichts Wesentliches, wenn man vorschlägt, der Staat solle das mit Geld finanzieren, das er herausgibt. Die Verteilungswirkungen (und damit die Widerstände) werden letztlich ähnlich sein, aber sie sind viel schwerer durchschaubar.
Wenn man alles auf die Frage zurückführt, wie der Staat das Geldsystem verwaltet und nutzt, läuft man Gefahr, den Verteilungsstreit übermäßig aus dem Blick zu nehmen, so wie das auch schon die Neoliberalen tun. Man tut es ihnen dann auf andere Weise gleich, indem man argumentiert, als sei das alles eine Sache des gesunden Menschenverstands. So macht man es der Gegenseite leicht, denn diese tut nichts lieber, als der Verteilungsdiskussion auszuweichen, indem man stattdessen scheinbar erkenntnisgetriebene Diskussionen um die richtige Theorie führt.
Im Lichte dieser Kritik lade ich dazu ein, die folgende zweite Leseprobe zur Arbeitsmarktpolitik zu lesen, die ich am Ende auch noch einmal kurz kommentieren will. (Fettungen im Text von mir.)
Antwort von Maurice Höfgen
Die Verteilungsfrage ist relevant, sehr relevant. Ungleichheit schadet dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Demokratie. Wenn wir die Verteilungsfrage, aber mit der Finanzierungsfrage („wie sollen wir das bezahlen?“) vermischen, machen wir uns zusätzliche Probleme. Ein Verständnis des Geldsystems zeigt: wir können heute schon die öffentliche Daseinsvorsorge ausweiten, unfreiwillige Arbeitslosigkeit reduzieren und in die Zukunft investieren. Wir müssen nicht auf Robin Hood warten. Wenn wir das allerdings davon abhängig machen, den Vermögenden vorher Geld aus der Tasche zu ziehen, dann verschwenden wir kostbare Zeit. Daher: erst Jobs, soziale Sicherheit und Investitionen und danach die Demokratie vor zu viel ökonomischer Macht der Eliten beschützen.
Leseprobe 2
10 #Jobgarantie: Das Ende unfreiwilliger Arbeitslosigkeit
(..) Dieser [MMT-]Logik folgend entsteht unfreiwillige Arbeitslosigkeit – definiert als Personen, die nach Arbeit suchen, für die sie in der staatlichen Währung bezahlt werden –, wenn der Wunsch der Währungsnutzer, die staatliche Währung zu akkumulieren, nicht ausreichend erfüllt wird. Das gilt, solange es Personen gibt, die in staatlicher Währung bezahlte Arbeit suchen, um an die herausgegebene Währung zu gelangen. Der Staat hat mit der Auferlegung der Steuerpflicht mehr Anbieter von Arbeit geschaffen, als er augenscheinlich für die Erfüllung seiner staatlichen Aufgaben benötigt, denn würde er die Arbeitssuchenden brauchen, hätte er sie ja angestellt.
Der Staat hat also einen Fehler gemacht. Mit anderen Worten: Unfreiwillige Arbeitslosigkeit ist eine wirtschaftspolitische Entscheidung des Staates und folglich der ultimative Beweis dafür, dass die Staatsausgaben nicht hoch genug sind – entweder ist der Staatsüberschuss zu groß oder das Staatsdefizit zu gering. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, kann der Staat über eine Jobgarantie (JG), als Teil einer aktiven Fiskalpolitik, die Staatsausgaben um genau die Menge erhöhen, die zur Befriedigung des Wunsches des Privatsektors die staatliche Währung zu akkumulieren sowie zur Erreichung von Vollbeschäftigung nötig ist.
Der Staat macht ein bedingungsloses Jobangebot an jeden, der in einem aufs Gemeinwohl ausgerichteten Job zu einem sozialverträglichen Lohn inklusive Lohnnebenleistungen arbeiten möchte. Ganz wichtig ist, dass die JG ausdrücklich eine Option ist, keine Verpflichtung. Die JG verkörpert die Erkenntnis, dass es die Verantwortung des Staates ist, die nötigen Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, wenn der Privatsektor hierzu nicht in der Lage ist – was man, wie erklärt, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft auch nicht vom Privatsektor verlangen kann.
Das JG-Programm ist als ein Pufferbestand an bezahlten Jobs zu verstehen, der expandiert, wenn die privatwirtschaftliche Aktivität zurückgeht und kontrahiert, wenn die privatwirtschaftliche Aktivität steigt. Das bedeutet, dass die Beschäftigungsanzahl innerhalb der JG und damit zusammenhängend auch die Staatsausgaben während eines Booms abnehmen und, andersherum, während einer Rezession zunehmen. (..)
Die makroökonomischen Gründe für Arbeitslosigkeit – nämlich eine zu geringe Gesamtnachfrage – bleiben im Diskurs zumeist unberücksichtigt. Im Vorfeld des neoliberalen Zeitalters war Vollbeschäftigung ein explizites wirtschaftspolitisches Ziel, auf das Fiskal- und Geldpolitik entsprechend zugeschnitten wurden. Die neoliberale Denkweise hat dies leider zurückgedrängt und mit einem Wahn nach Preisstabilität ersetzt.
Dieser Wahn geht so weit, dass ein gewisses Level permanenter unfreiwilliger Arbeitslosigkeit gar zum wirtschaftspolitischen Mittel wurde – bekannt unter dem englischen Akronym NAIRU für »Non Accelerating Inflationary Rate of Unemployment«, zu Deutsch »eine Inflation nicht beschleunigende Arbeitslosenquote«. Dabei wird eine »Reservearmee an Arbeitslosen« genutzt, um Forderungen nach Lohnerhöhungen zu disziplinieren und eine inflationäre Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Vollbeschäftigung und Preisstabilität werden dementsprechend als Widerspruch gesehen.
Sobald die inflationsstabile Arbeitslosenquote, deren Berechnung und Definition fast waghalsiger Willkür gleicht, erreicht wird, werden wirtschaftspolitische Maßnahmen getroffen, um einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das hat nicht nur brutale soziale Konsequenzen für diejenigen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, sondern entlarvt auch das Argument, dass Arbeitslosigkeit ein Problem individueller Wettbewerbsfähigkeit sei.
Mein Kommentar
Hier stehen zwei Sichtwiesen gleichberechtigt nebeneinander, die sich schlecht vertragen. Einerseits Arbeitslosigkeit als Fehler im System aufgrund eines fehlerhaften Verständnisses makroökonomischer Zusammenhänge, andererseits Arbeitslosigkeit als elementarer Teil des Systems, als Gewährleistung einer Reservearmee williger, unterbeschäftigter Arbeitskräfte, damit die Arbeitnehmer und ihre Vertreter dem Kapital keinen größeren Teil des erwirtschafteten Kuchens abverlangen.
Sicherlich ist an beiden Sichtweisen etwas dran. Aber wenn man reformerisch tätig sein will, muss man sich schon entscheiden, ob man das Grundproblem in einem falschen Verständnis der Zusammenhänge sieht. Dann ist das Wichtigste und fast schon Ausreichende, die Aufklärung. Oder ob man die verfolgten Interessen der Mächtigen als Ursache der kritisierten Zustände ansieht. Dann sind die falschen Lehren und daraus folgenden Missverständnisse eher Mittel zum Zweck als Ursache. Auch dann hilft es, über die wahren Zusammenhänge aufzuklären. Aber es ist dann bei weitem nicht ausreichend.
Höfgens Buch ist gerade deshalb eine lohnende Lektüre, weil es durch die gute Verbindung von theoretischen Erläuterungen und wirtschaftspolitischen Folgerungen dazu einlädt, und eine gute Basis dafür liefert, solche Überlegungen anzustellen und solche Kritikpunkte zu entwickeln. Wer sich im linken Lager verortet, kommt ja kaum noch ohne eine Haltung zur MMT aus. Mir als Leser und Rezensent hat Höfgens Buch in dieser Richtung einen Klarheitsgewinn verschafft.
Antwort von Maurice Höfgen
Beides ist der Fall. Wer reformieren will, muss aufklären und (politische) Kräfteverhältnisse verändern.
